ein Interview mit Jöran Muuß-Merholz, Autor des Buchs „Barcamps & Co. Peer to Peer-Methoden für Fortbildungen“
Das folgende Interview erschien unter dem Stichwort „agile Fortbildung“ in einer redigierten und gekürzten Version gedruckt als: Jöran Muuß-Merholz: Barcamps und das Peer-to-Peer-Lernen als Medien agiler Fortbildung. Warum digitale Medien darin so prominent sind. In: SchulVerwaltung spezial 3/2022 (24. Jg.). S. 112-114. (Wolters-Kluwer)
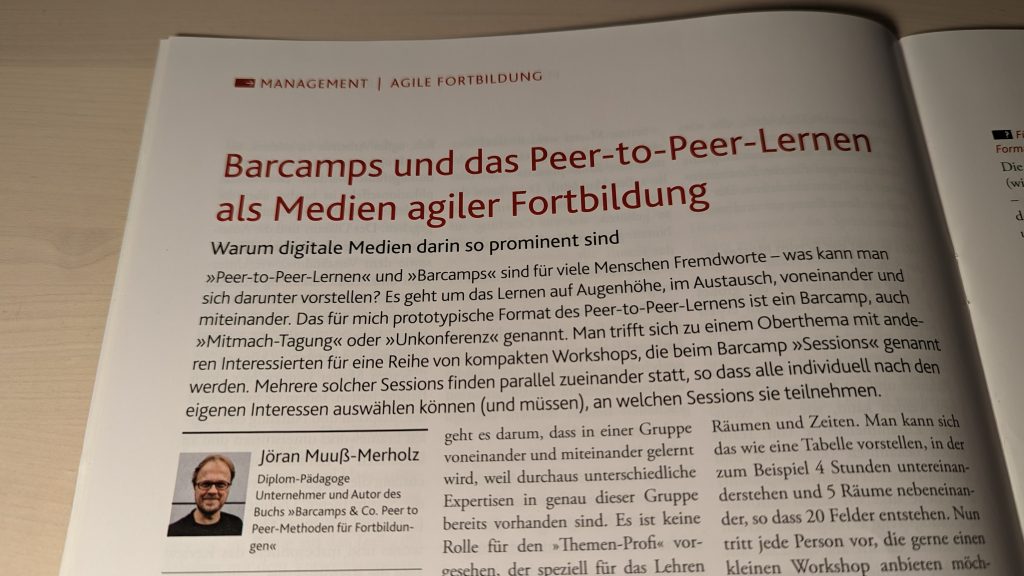
„Peer-to-Peer-Lernen“ und „Barcamps“ sind für viele Menschen Fremdworte – was kann man sich darunter vorstellen?
Es geht um das Lernen auf Augenhöhe, im Austausch, voneinander und miteinander. Das für mich prototypische Format des Peer-to-Peer-Lernens ist ein Barcamp, auch „Mitmach-Tagung“ oder „Unkonferenz“ genannt. Man trifft sich zu einem Oberthema mit anderen Interessierten für eine Reihe von kompakten Workshops, die beim Barcamp „Sessions“ genannt werden. Mehrere solcher Sessions finden parallel zueinander statt, so dass alle individuell nach den eigenen Interessen auswählen können (und müssen), an welchen Sessions sie teilnehmen. Das Besondere am Format: Zu Beginn ist der Themenplan noch leer. Dann steht einfach jede und jeder auf, der ein Thema bearbeiten und entsprechend eine Session dazu anbieten möchte. Auf diese Weise entsteht quasi ad-hoc ein Themenplan, der ausschließlich an den aktuellen Interessen der Teilnehmenden orientiert ist.
Was ist die Grundidee hinter diesem Peer-to-Peer-Lernen?
„Peer-to-Peer“, das bedeutet ja so viel wie „von gleich zu gleich“ oder „unten Gleichen“. Das Gegenteil von Peer-to-Peer-Lernen wäre also ein Lernen von Nicht-Gleichen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ich als Experte für digitale Zusammenarbeit in eine Schule für einen Vortrag vor Lehrkräften eingeladen werde. Das ist dann eine asymmetrische Expertenrolle: Ich kenne mich gut mit digitaler Zusammenarbeit aus, aber nicht gut mit der Praxis der Lehrkräfte. Häufig ist dieses Lernen eher ein Modus des Belehrt-Werdens als ein aktives Lernen.
Beim Peer-to-Peer-Lernen geht es darum, dass in einer Gruppe voneinander und miteinander gelernt wird, weil durchaus unterschiedliche Expertisen in genau dieser Gruppe bereits vorhanden sind. Es ist keine Rolle für den „Themen-Profi“ vorgesehen, der speziell für das Lehren oder für das Fortbilden zuständig ist und nicht selbst zur Gruppe gehört.
Sind denn nicht auch Praktikerinnen und Praktiker „Profis“?
Das ist ein zentraler Punkt! Wenn ich davon spreche, dass Peer-to-Peer-Lernen „ohne Profis“ stattfindet, meine ich damit, dass niemand dafür engagiert wird, dass er oder sie für die thematische Expertise zuständig ist – zumindest nicht alleine zuständig ist. Die Lehrkräfte sind Profis für ihre eigene Praxis. Sie sind in dieser Hinsicht auch Expertinnen und Experten. Wir haben bisher im traditionellen Modus von Fortbildung „Expertise“ in der Regel darüber definiert, dass jemand die Expertise in seiner Jobbeschreibung stehen hatte. Jemand war mehr oder weniger formal als Experte oder Expertin definiert und hat dann die anderen fortgebildet. Aber „Expertise“ ist nicht darauf begrenzt, ein systematisches, umfassendes, akademisches Wissen zu einem Thema zu haben. Den Expertenstatus kann nicht nur jemand beanspruchen, bei dem „Experte“ auf der Visitenkarte steht. Vielmehr haben wir alle für diejenigen Themen Expertise, zu denen wir über viel Erfahrung, am besten reflektierte Erfahrungen verfügen. Diese Expertise wird durch Peer-to-Peer-Formate sichtbar und nutzbar gemacht.
Nochmal zurück zum Barcamp, wie genau läuft das ab?
Es braucht festgelegte Zeiten, Räume für paralleles Arbeiten und einen großen Raum für das Plenum – und natürlich ein gemeinsames Thema. Das Thema kann sehr weit gefasst sein oder eine spezifische Fragestellung sein. Es ist nur wichtig, dass es vorab feststeht, so dass alle wissen, was der gemeinsame Rahmen ist.
Zu Beginn gibt es einen leeren Plan mit Räumen und Zeiten. Man kann sich das wie eine Tabelle vorstellen, in der zum Beispiel 4 Stunden untereinander stehen und 5 Räume nebeneinander, so dass 20 Felder entstehen. Nun tritt jede Person vor, die gerne einen kleinen Workshop anbieten möchte. Beim Barcamp spricht man von „Sessions“. Dann wird über Handzeichen unverbindlich abgefragt, wie groß das Interesse an der Teilnahme der Session ist. Das dient dazu, diese Session in einen kleinen oder großen Raum einzuordnen. Auf diese Weise füllt sich die Tabelle und wird so zum sogenannten „Sessionplan“. Wenn der feststeht, machen sich alle ein Foto davon oder bekommen einen Link zum Plan. (Man kann den auch ausdrucken.) Auf dieser Grundlage entscheiden sich alle Teilnehmenden zu Beginn jeder Stunde, an welchen Sessions sie teilnehmen. Man kann auch mittendrin wechseln, wenn man den Eindruck hat, in einer Session nichts mehr beizutragen.

Und die einzelnen Sessions sind dann einfach Workshops?
Ein Workshop kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Und das gilt bei Sessions noch stärker. Ganz wichtig ist: Man erwartet von der Person, die eine Session anbietet, nicht die Rolle, die man im traditionellen Modus von einer Fortbildnerin erwartet hätte. Es kann zwar durchaus auch Folienvorträge oder Übungen geben. Aber es ist mindestens genau so willkommen, dass eine Session mit einer offenen Frage gestartet wird. Die Vorstellung dieser Session lautet dann typischerweise: „Mich beschäftigt die Frage xyz. Ich suche Menschen, die sich dazu mit mir austauschen wollen.“
Für welche Themen eignet sich das Format Barcamp?
Die Antwort auf diese Frage lautet (wie so oft): „Es kommt drauf an!“ – nicht nur auf das Thema, sondern auch auf die Vorbedingungen und die Zielsetzungen. Damit ein Barcamp sinnvoll ist, müssen einige Punkte zusammenkommen:
- Ein Barcamp kann nur funktionieren, wenn die Teilnehmenden ein Mindestmaß an Motivation und Initiative mitbringen. Jedes Peer-to-Peer-Format kann nur so gut werden, wie die Teilnehmenden es machen. Sie setzen die Themen, sie bestimmen die Formen, sie entscheiden über die Teilnahme. In der Barcamp-Sprache spricht man gerne davon, dass die Teilnehmenden auch „Teilgebende“ sein müssen.
- Ein Barcamp passt nicht gut, wenn die Lernziele für alle Beteiligten gleich sein sollen. Das typische „Wir wollen alle auf einen Stand bringen!“ geht hier nicht. (Das wäre zum Beispiel für einen Erste-Hilfe-Kurs problematisch.)
- Ein Barcamp setzt voraus, dass in der Gruppe eine kritische Masse an Erfahrungen und Vorwissen vorhanden ist. Das muss keineswegs gleich verteilt sein. Es braucht aber genug Expertise, dass Mitglieder der Gruppe gute Fragen formulieren oder eigenes Wissen weitergeben können. Ein Barcamp passt besonders zu Themenbereichen, die für alle Teilnehmenden relevant sind und zu denen die Teilnehmenden unterschiedliches Vorwissen, unterschiedliche Erfahrungen und eigene Perspektiven mitbringen.
- Zielsetzungen wie Austausch und Weiterentwicklung passen gut zu einem Barcamp. Das Format ist auch gut für die Erkundung von Themenfeldern geeignet. Was gehört (für uns) eigentlich dazu? Was gibt es dazu bei uns schon? Wer kann bei uns was von wem wie lernen?
- Und schließlich: Das Format ist nur schwer mit traditionellem Hierarchiedenken vereinbar. Vorgesetzte und Autoritäten müssen akzeptieren, dass andere Menschen etwas besser wissen oder eigene Erfahrungen auf Augenhöhe einbringen.
Diese Punkte lassen sich übrigens vom Format Barcamp im Besonderen auf Peer-to-Peer-Lernen im Allgemeinen übertragen.
Das war bisher etwas abstrakt. Können Sie einige Beispiele nennen?
Die Methode Barcamp ist ungeheuer vielseitig! Ich habe Barcamps mit 20 und mit 300 Personen, mit einer Dauer von 3 Stunden und für 3 Tagen durchgeführt. Da war zum Beispiel die internationale Unternehmensgruppe mit Manager*innen aus verschiedenen Ländern. Die wollten sich über aktuelle Herausforderungen in ihrem Arbeitsfeld austauschen, sich gegenseitig ihre Erfahrungen und Arbeitsweisen vorstellen und gemeinsam weiterentwickeln. Ein anderes Beispiel: die Schule, die für einen Pädagogischen Tag ihr Schulmotto „Vielfalt ist willkommen!“ von verschiedensten Seiten beleuchten wollte, um eine Bestandsaufnahme zu machen und mögliche Weiterentwicklungen zu erkunden. Oder die Führungskräfte eines Schulministeriums, die sich dazu ausgetauscht haben, wie sie mit Nachwuchs-Führungskräften umgehen. Es gibt auch öffentliche Barcamps, zu denen Menschen nach Interesse zusammenkommen, z.B. die seit 2009 regelmäßig stattfindenden EduCamps. Das EduCamp findet 2x im Jahr statt und hat inzwischen viele Ableger bekommen, zum Beispiel das Corporate Learning Camp, das Medienpädagogik PraxisCamp, das Barcamp Politische Bildung, das Projekt jugend.beteiligen.jetzt und viele mehr.
Inwieweit können Barcamps in der Praxis vom ursprünglichen Format abweichen?
Ich bin überzeugt davon, dass es ein zentraler Vorteil des Formats Barcamp ist, dass es sich sehr flexibel anpassen lässt. Das betrifft zum Beispiel die Dauer der Sessions. Wir haben sowohl Barcamps gemacht, wo jede Session nur 20 Minuten gedauert hat, als auch Formate mit einzelnen Sessions über drei Stunden. Insbesondere lässt sich die Methode Barcamp mit anderen Methoden kombinieren. Wir veranstalten seit 2012 das OERcamp (da geht es um freie und offene Lehr-Lern-Materialien), und das Format haben wir in unterschiedlichen Varianten genutzt. Am Anfang war es ein reines Barcamp. Als immer mehr Menschen dazu kamen, die über die Veranstaltungen auch einen Einstieg ins Thema gesucht haben, haben wir die Hälfte der Veranstaltungszeiten für vorgeplante Workshops genutzt, um bestimmte Themen gezielt abdecken zu können. Und mein bisheriges Highlight war eine Variante, die wir „OERcamp Werkstatt“ genannt haben, wo Menschen für zwei Tage an je eigenen Projekten gearbeitet haben, sich über Sessions untereinander ausgetauscht haben und von einer Reihe von Coaches zusätzlichen Input und Beratung bekommen haben.
Das klingt kaum noch nach einem Barcamp. Was macht dann den Kern des Formats aus?
Es gibt durchaus Menschen, die zu starke Variationen kritisieren und sagen: „Das ist jetzt aber kein Barcamp mehr!“ Ich bin da eher offen. Es gibt für mich drei Elemente, die bei einem Barcamp vorhanden sein müssen, damit es den Namen Barcamp verdient: 1. Jede teilnehmende Person muss die Möglichkeit haben, eine Session selbst anzubieten. Ein von vornherein feststehendes Programm kann es in Teilen geben – aber es muss offen bleiben. 2. Es sollte keine Mindestgröße pro Session und keine maximale Anzahl von Sessions vorgegeben werden. Eine Session kann stattfinden, sobald sich zwei Personen dafür interessieren. 3. Wenn es sowohl offenes Barcamp-Programm als auch vorgeplantes, nicht offenes Programm gibt, dann sollten diese beiden Komponenten nicht parallel zueinander stattfinden, sondern nacheinander.
Noch einmal zurück zum Peer-to-Peer-Lernen. Wenn ein Barcamp ein prototypisches Format ist, wie sieht das Peer-to-Peer-Lernen dann allgemein aus?
Peer-to-Peer (oder kurz „P2P“) heißt „zwischen gleichen Personen“ im Sinne von „Personen mit ähnlichen Interessen und Erfahrungen“. Es geht also um Formen, in denen viel miteinander und voneinander gelernt wird. Peer-to-Peer-Formate sind Formen des gemeinsamen Lernens, in denen die starre Trennung in Lehrende und Lernende aufgehoben wird. Der Begriff Peer-to-Peer baut auf das englische Wort peer (ausgesprochen wie der deutsche „Pier“) auf, was so viel wie „Gleichrangige“ oder „Ebenbürtige“ meint. Es geht also um Formen, in denen Menschen ebenbürtig voneinander und miteinander lernen. Manchmal übernehmen einige (oder alle) Beteiligte dabei auch die Aufgaben von Lehrenden – aber nicht auf Dauer, sondern immer in Bezug auf ein konkretes Thema oder eine bestimmte Aufgabe.
Was sind die gemeinsamen Eigenschaften solcher Formate?
Die gemeinsamen Eigenschaften von P2P-Formaten sind:
- Es sind Formen, in denen Lernende sich zusammenschließen, um miteinander und voneinander zu lernen.
- Es sind Formen, in denen die starre Trennung in Lehrende einerseits und Lernende andererseits aufgehoben wird.
- Es sind Formen, in denen hohe Flexibilität für Inhalt und Vorgehen besteht.
- Es sind Formen, in denen Austausch und Aushandeln einen höheren Stellenwert haben und in denen unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven willkommen sind.
- Es sind Formen, die besonderen Wert auf die Prozesshaftigkeit des Lernens legen.
- Es sind Formen, die ein hohes Maß an Kommunikation versprechen und verlangen.
- Es sind Formen, die viel Aktivität der Teilnehmenden ermöglichen und erfordern.
Was sind andere Formate des Peer-to-Peer-Lernens?
In vielen Schulen gibt es Mikro-SchiLFs. Da gibt es zum Beispiel einmal pro Woche einen kurzen Input zu einem festgelegten Oberthema, und jede Woche übernimmt eine andere Person aus dem Team / aus dem Kollegium die Vorbereitung. Oder man hat einen gemeinsamen Verteiler, z.B. als Forum, Messenger-Gruppe oder E-Mail, an die alle nicht nur empfangen, sondern auch senden können. Sehr beliebt ist auch das Format der offenen Sprechstunde, wo man zu einem bestimmten Thema nicht nur Ansprechpartner*innen findet, sondern im besten Fall auch Kolleg*innen mit ähnlichen Interessen.
Das klingt nicht unbedingt spektakulär, oder?
Richtig! Es geht im Kern nicht um vollkommen neue Methoden mit seltsamen Namen. Die Grundidee lässt sich mindestens bis zur Aufklärung zurückverfolgen, als Menschen so etwas wie „Lesegesellschaften“ gründeten. Dort trafen sich Menschen (i.d.R. Männer, um präzise zu sein) nicht nur des Lesens wegen, sondern um miteinander und voneinander zu lernen.
Schon Anfang des 19. Jahrhunderts gab es ein Peer-to-Peer-Fortbildungsformat speziell für Lehrer: die „Schullehrerkonferenzgesellschaften“. Das war eine Erfindung des preußischen Schulverwaltungsbeamtens Bernhard Christoph Ludwig Natorp. Er hat das bewusst als Form des pädagogischen Austauschs untereinander und des Lernens voneinander konzipiert. Wenn ich das richtig verstehe, dann geschah das damals aus der Not heraus, weil es keine Ressourcen für eigentlich notwendige Fortbildungen gab.
Was ist dann heute tatsächlich neu?
Ich sehe zwei Dinge, die eine andere Qualität in dieses Lernen bringe, das ich „Selbst-Fortbildung“ nenne. Das erste ist der Bedarf an Fortbildung bzw. die Umstände, die einen Dauer-Fortbildungsmodus verlangen – dazu kann ich gleich noch etwas sagen. Das zweite ist der digitale Wandel.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung?
Spätestens seit Corona sind die Möglichkeiten der digitalen Welt für die Fortbildung auch für die Schule aus einer Nische herausgekommen. Allerdings macht man auf der Ebene des Erwachsenen die gleichen Fehler, die man schon in Bezug auf die Schüler*innen beobachten konnte: Lerngelegenheiten im Internet werden in erster Linie so wahrgenommen, dass sich Menschen individuell bzw. isoliert mit einem Informationsangebot auseinandersetzen. Man ignoriert, dass die meisten Menschen gut und gerne lernen, wenn sie sich dafür zusammentun, miteinander und voneinander lernen können.
Sind die Chancen an „digitales Lernen“ überbewertet?
Große Verheißungen, Digitalisierung ermögliche „Bildung für alle“ oder „Fortbildung jederzeit an jedem Ort“, suggerieren, dass man nur den eigenen Kopf irgendwie mit dem Internet verbinde müsse, dann würde die Fortbildung schon in den Kopf hinein fließen. So funktioniert Lernen nicht. Erstens ist das Miteinander mit anderen Menschen für unser Lernen wichtig. Wir lernen offenbar gerne und gut mit anderen zusammen, voneinander, miteinander und manchmal auch einfach nur nebeneinander. Zweitens überfordert das Lernen mit dem Internet viele von uns in Sachen Eigenmotivation und Selbststeuerung. Das können wir nicht richtig gut. (Man könnte sogar sagen: Die Bildungsinstitutionen haben es uns ausgetrieben. Dort wurden wir ja immer bedient und mussten nicht lernen, mit Selbstbedienung zurecht zu kommen.) Tolle Lernmaterialien alleine reichen also nicht. Es geht darum, dass wir uns nicht trotz, sondern gerade angesichts unendlicher digitaler Lernmöglichkeiten treffen und in neuen Formen lernen können. Zugespitzt formuliert: Es geht nicht um die Alternative „Onlinekurs im Internet vs. Workshop an einem Tisch“, sondern um die Alternative „Onlinekurs, bei dem jeder für sich alleine lernt vs. Onlinekurs, bei dem man sich in Lerngruppen an einem Tisch dazu austauscht“. Peer-to-Peer-Formate sind ein fehlendes Bindeglied, eine Brücke zwischen den neuen Möglichkeiten der digitalen Bildungswelt und den Anforderungen und Möglichkeiten von echten Menschen.
Sind das theoretische Möglichkeiten – oder passiert das schon „im echten Leben“?
Wir stehen am Anfang, was die sinnvolle Nutzung von digitalen Medien für die Fortbildung angeht. Aber die Anfänge sind inzwischen klar zu beschreiben. Es entsteht zudem so etwas wie eine öffentliche Kultur des Teilens. Menschen teilen Erfahrungen und Fragen im Twitterlehrerzimmer, teilen eigene Materialien als Open Educational Resources (OER) – also potentiell weltweit.
Ist das nicht immer noch eher eine Ausnahme?
Das ist immer noch eine Ausnahme. Aber inzwischen findet man vermutlich in jedem Kollegium durchschnittlich (!) eine Person, die so etwas macht. Und weniger öffentlich passiert vieles, was wir naturgemäß nur anekdotisch wahrnehmen können, zum Beispiel regelmäßige Mikrofortbildungen, Sprechstunden, Werkstattformate.
Warum braucht es überhaupt diese „Selbst-Fortbildungen“?
Schulen befinden sich in mehreren tiefgreifenden Wandeln, die miteinander verflochten sind. Man kann das auf zwei Ebenen durchdeklinieren. Da sind einmal die großen gesellschaftlichen Themen, mit denen Schulen sich in den letzten Jahren auseinandersetzen mussten, insbesondere Inklusion, Digitalisierung, Geflüchtete und Corona. (Eigentlich fehlen in dieser Aufzählung Klimakrise, Artensterben und Krise der Demokratie. Aber in diesen Feldern ist das Gesamtsystem Schule noch recht resistent …) Das sind alles enorme Herausforderungen an Schule, denen man sich stellen musste, ohne dass „fertige Antworten“ vorlagen, die man nur noch anwenden müsste. Die Leute im Change Management nutzen gerne die Metapher vom Jogger, der sich beim Laufen umziehen soll. Das ist schwierig – entweder er läuft weiter, dann kann er sich aber nicht umziehen. Oder er bleibt zum Umziehen stehen – dann läuft er aber nicht weiter. Schule muss dieses Spannungsfeld aushalten und jeden Tag weiter machen, jeden Tag handlungsfähig bleiben, noch während wir herausfinden, wie wir mit den neuen Umständen konstruktiv umgehen können. Ich sage dazu gerne: „Wir arbeiten im Herausfindemodus.“ Das heißt auch, dass sich die traditionelle Trennung in den Modus „normales Arbeiten“ und den Modus „jetzt Lernen / Fortbilden“ auflöst.
Sie sprachen von zwei Ebenen, welches ist die zweite?
Die zweite Ebenen, auf der große Baustellen in den Schulen anstehen, haben weniger gesellschaftliche Sichtbarkeit, sind aber nicht weniger wichtig. Hier geht es zum Beispiel um den Wandel hin zu Teamarbeit, also zu neuen Formen von Zusammenarbeit und Arbeitsteilung. Oder auf der didaktischen Ebene um die andauernde Herausforderung, vom Belehren zum eigenständiges Lernen der Schülerinnen und Schüler.
Das sind jetzt sehr unterschiedliche Herausforderungen. Was sind die gemeinsamen Eigenschaften dieser Beispiele?
In meinem Buch beschreibe ich vier Eigenschaften, die ein typischer Fortbildungsbedarf der Gegenwart hat, bei dem ein auf Stabilität ausgerichtetes System (wie Schule) an seine Grenzen kommt und sich neu ausrichten und Dynamik entwickeln muss.
Der Fortbildungsbedarf ist ungeduldig und aktuell. Es eilt und kann nicht warten.
Es geht um unsichere und dynamische Entwicklungen. Die Dinge verändern sich, noch während wir darüber sprechen.
Es geht um ungenaue und um multiperspektivische Inhalte. Es gibt nicht die eine richtige Lösung, sondern braucht unterschiedliche Perspektiven und anpassbare Lösungen.
Die Dinge sind unabgeschlossen und prozessorientiert. Es wird zum Normalfall, dass wir kontinuierlich weiterentwickeln und uns ständig fortbilden.
Wird das nicht auch als sehr anstrengend wahrgenommen?
Das ist definitiv alles andere als einfach. Und es ist für die Akteure in Schulen nur bedingt tröstlich, dass sie nicht alleine sind. In ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen stellen sich die gleichen Herausforderungen. Es braucht neue Fortbildungsformate, in denen Lösungen nicht nur vermittelt werden, noch nicht mal nur gemeinsam GEFUNDEN, sondern regelrecht ERFUNDEN werden müssen. Damit geht es in Fortbildungen nicht alleine um die Frage „Wie funktioniert das?“, sondern hintergründig müssen auch oft die Fragen „Wie wollen wir arbeiten?“ oder gar „Wie wollen wir leben?“ stetig neu ausgehandelt werden. Aber das kann man ja auch positiv formulieren: Im neuen Fortbildungsmodus lernen wir – und gleichzeitig gestalten wir dabei ein Stück unserer Zukunft selbst.
Das klingt nach einem guten Schlusswort. Alles wird gut?
Mit neuen Formen von Selbst-Fortbildung und Peer-to-Peer-Lernen sind großartige Möglichkeiten verbunden. Allerdings gibt es die Gefahr, dass damit die Verantwortung für große gesellschaftliche Herausforderungen auf die individuelle Ebene abgeschoben wird. Nach dem Motto: „Ja, Digitalisierung ist groß und schwierig. Und die Leute an der Basis wissen am besten, wie neue Lösungen aussehen. Die sollen mal machen!“ Oder so wie vor 200 Jahren bei den „Schullehrerkonferenzgesellschaften“: Wir haben keine Ressourcen für Schulentwicklung und Fortbildung – dann delegieren wir das einfach an die handelnden Personen.
Die neuen Anforderungen bedeuten keineswegs eine Entlastung für Verantwortliche in Administration und Politik, im Gegenteil! Sie müssen für Rahmenbedingungen, Ressourcen, Unterstützung und Rückendeckung sorgen, damit der neue Modus von Lernen und Fortbildung entwickelt werden kann.
Sie haben jetzt nicht einmal das Wort „Agilität“ benutzt …
Das liegt wohl daran, dass ich eine gewisse Skepsis gegenüber dem Begriff „agil“ habe. Immer wenn jemand „agil“ sagt, frage ich mich, was damit gemeint ist. In manchen Fällen geht es um einzelne Methoden wie Scrum – aber dann sollte man das besser auch konkret bezeichnen. Nach meiner Einschätzung ist es inzwischen die Regel, dass „agil“ einfach als Gegenbegriff zu „starr“ oder „passiv“ oder „bürokratisch“ oder „unflexibel“ oder „verkrustet“ benutzt wird. Das klingt dann vielleicht moderner, aber es birgt die Gefahr von Pseudokonsens. Man ist sich schnell einig, dass es nicht starr und nicht unflexibel und nicht verkrustet sein soll – aber eine positive Beschreibung ist damit noch nicht gegeben. Man hat nur einen schmalen Konsens, dass es „irgendwie anders als bisher“ sein soll.
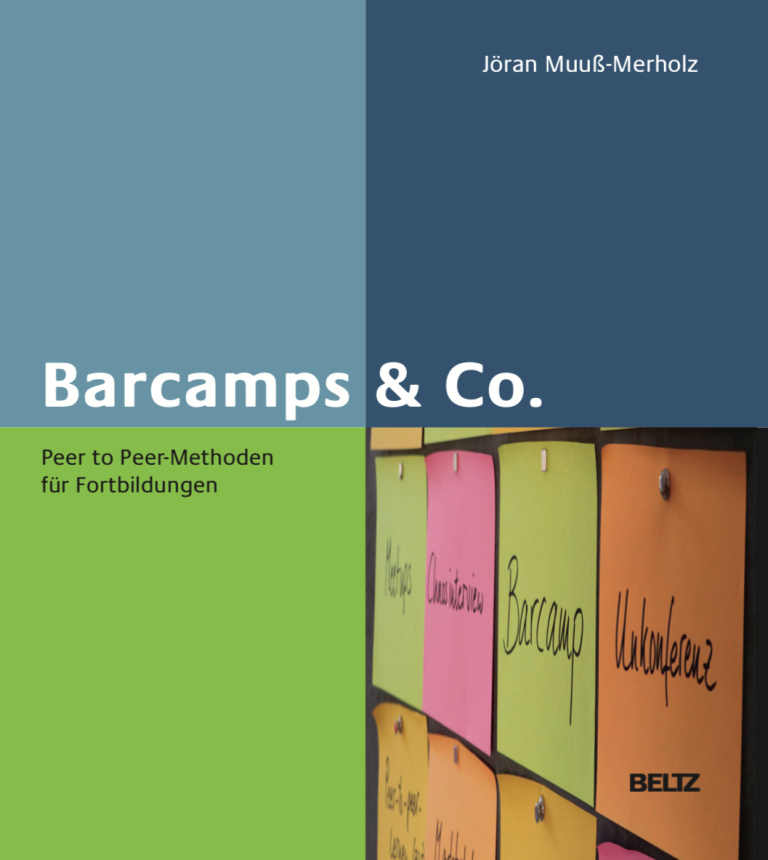
Barcamps & Co. Peer to Peer-Methoden für Fortbildungen | von Jöran Muuß-Merholz | Beltz | 2019 | Hardcover | 238 Seiten | € 24,95 | ISBN: 978-3407366993 | offen und frei über die Website selbstlernen.net verfügbar.
Im corporate learning mag das alles noch exotisch und eher die Ausnahme sein. Wenn wir allein auf die Kombination aus Discord, Youtube und Twitch schauen finden dort de facto jeden Tag tausende Barcamps statt, nur dass sie da nicht so heißen.
Agilität ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je;)
Emanuel