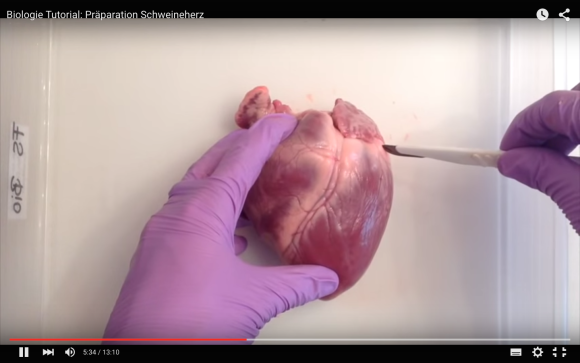
Pioniere und Avantgarde
Eine Anmerkung für alle, die diesen Text in ferner Zukunft lesen: 2015 war es in Deutschland die Ausnahme von der Regel, wenn digitale Medien im Schulunterricht genutzt wurden. Fast alle anderen gesellschaftlichen Bereiche waren vom digitalen Wandel erfasst worden – alleine das Bildungswesen und insbesondere die Schule zögerten. 2015 war die Entscheidung für digitale Medien im Unterricht maßgeblich davon abhängig, ob sich einzelne Schulleitungen und vor allem Lehrkräfte mit individuellem Engagement auf neue Wege wagten.
Dieser Artikel stammt aus der Einleitung der Publikation „Chancen der Digitalisierung für individuelle Förderung im Unterricht – zehn gute Beispiele aus der Schulpraxis“. Mehr dazu …
Vor diesem Hintergrund kann man die vorliegenden zehn Beispiele nicht nur als Fallstudien von Unterricht verstehen, sondern auch als Porträt und Anerkennung der konkreten Lehrkräfte, die als Pioniere und Avantgarde gelten können.
Selbstverständlich sind zehn Gespräche keine ausreichende Grundlage, um daraus allgemeingültige Folgerungen zu ziehen. Einige übergreifende Beobachtungen sollen aber im Folgenden skizziert werden, auch um Diskussionsanstöße zu liefern, die die Debatte vorantreiben. Sie sollen einen kleinen Baustein für den Weg von der Avantgarde hin zur Etablierung in der Breite liefern.
These 1: Auf den Pädagogen kommt es an!
Um es vorweg zu nehmen: Alle interviewten Lehrkräfte wären sicherlich auch ohne digitale Medien tolle Pädagogen und Pädagoginnen. Ihr Unterricht ist klar strukturiert und von einem hohen Anteil an Lernzeit gekennzeichnet. Ihre Methoden sind abwechslungsreich und aktivierend. Mit digitalen Medien erweitern sie ihr professionelles Handlungsrepertoire und die Lernwelt der Schüler.
Umgekehrt gilt (auch wenn dafür kein Beispiel in den zehn Fallstudien vorliegt): Auch mit digitalen Medien kann man schlechten Unterricht machen.
Insofern sind die zehn Praxisfälle nicht nur Beispiele für den Einsatz digitaler Medien, sondern auch für guten Unterricht. Die Grundfrage lautet nicht: „Wie können wir digitale Medien einsetzen?“, sondern vielmehr: „Wie gestalten wir Unterricht, in dem individuell und selbstgesteuert gelernt werden kann?“ Digitale Medien sind Teil der Antwort, nicht Teil der Frage.
These 2: Digitale Medien unterstützen den Rollenwandel für Schüler und Lehrkräfte.
Blickt man auf das Gesamtbild, das sich aus den zehn Beispielen ergibt, so erkennt man den Wandel der Lernkultur, wie er auch unabhängig vom Medieneinsatz in Deutschland diskutiert und gefordert wird. Der Lehrer ist nicht mehr (in erster Linie) Wissensvermittler, sondern (auch) Lerncoach und -berater, der den Schülern hilft, ihren eigenen Lernprozess erfolgreich zu gestalten.
Gleichzeitig werden die Schüler vom eher passiven Empfänger von Unterricht zu aktiven Lernenden. Ein Satz, der in den Interviews häufiger fiel, lautet: „Die Schüler können nicht mehr abtauchen.“ Positiv gewendet: Bei einer intelligenten Individualisierung und dem Einsatz digitaler Medien können Schüler ihre eigenen Interessen, Fähigkeiten und Begabungen stärker einbringen. Die digitalen Medien erhöhen die Verbindung zu ihrer Lebenswelt. So wurde in den Interviews mehrmals davon berichtet, dass Schüler bei der Arbeit mit Videos oder in einem Blog Talente einbringen konnten, von denen die Lehrkräfte vorher nichts ahnten.
Digitale Medien unterstützen dabei potentiell alle anstehenden Aufgaben. In den präsentierten Beispielen stehen dabei häufig die Informationsbeschaffung und die Produktion von Lernergebnissen im Vordergrund. Auch Übungen und Feedback mit digitalen Medien werden häufig hervorgehoben. Andere Themen wie adaptive Lernsoftware, Big Data oder Serious Games spielen bislang allenfalls eine untergeordnete Rolle.
These 3: Der Arbeitsaufwand für die Lehrkräfte verschiebt sich.
Keiner der interviewten Lehrkräfte hat über den zusätzlichen Aufwand geklagt, den die Nutzung digitaler Medien für ihren Arbeitsalltag bedeutet. Vielmehr besteht ein Konsens, dass sich der Aufwand für die Vorbereitungsphase von Unterricht erhöht, sich diese Investition aber im Unterricht selbst auszahlt, weil dann die Schüler „die Arbeit machen“. Die Lehrkraft wird bei schülerzentrierten Methoden davon entlastet, Inhalte vorzubereiten und zu präsentieren. Bei Input und Übungen liegen zwei Stärken digitaler Medien.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass digitale Medien die Lehrkraft überflüssig machen. Sie entlasten sie nur von bestimmten Aufgaben, vor allem beim Input und bei der Kontrolle von Schülerübungen. Die gewonnene Zeit wird in einem solchen Unterricht benötigt, um Schüler individuell begleiten und beraten zu können sowie um gemeinsame Phasen in Gruppen und im Plenum zu strukturieren. Eine Aktivierung der Schüler bedeutet also nicht eine passivere Rolle der Lehrkraft. In einem guten Unterricht sind alle Beteiligten aktiv.
These 4: More is different – digitale Medien ermöglichen eine neue Qualität.
Sehr häufig finden sich in den Fallbeispielen Aussagen, dass eine hochgradige Differenzierung von Materialien, Aufgabenstellungen, Kommunikation oder Lernprodukten auch ohne digitale Medien möglich war, nur dass der Aufwand um ein Vielfaches höher war. Daraus könnte man ableiten, dass mit digitalen Medien vor allem „mehr vom Selben“ möglich ist. Doch dieser Schluss greift zu kurz. Aus dem graduellen Unterschied kann ein qualitativer Unterschied werden.
Der Physik-Nobelpreisträgers P. W. Anderson hat im naturwissenschaftlichen Bereich die Beobachtung „More is different“ dokumentiert. Wenn der quantitative Unterschied eine bestimmte Größe erreicht, so verändert sich auch die Qualität eines Gegenstands. Mit digitalen Medien lässt sich nicht (nur) das Gleiche wie vorher einfacher oder schneller machen. Die informationelle Welt funktioniert mit digitalen Medien so radikal anders, dass auch die Welt von Lernen und Lehren grundsätzlich davon betroffen ist.
These 5: Kleine Dinge machen große Unterschiede.
Häufig sind es die vermeintlich kleinen Dinge, die große Unterschiede für die Praxis bedeuten. Das gilt auf der Ebene der Technik wie auch für den methodischen Unterrichtseinsatz. Ein Grund für die Beliebtheit von Tablet-Computern könnte darin liegen, dass sie die Zuverlässigkeit der Technik von 95 Prozent auf 99 Prozent steigern. Diese Veränderung macht den Unterschied, ob eine Lehrkraft sich auf die Technik verlässt oder sie nur als optionale Möglichkeit einplanen kann. Das gilt analog für die zeitliche Ebene: Für die Unterrichtspraxis macht es einen großen Unterschied, ob ein Schüler beim Nachschlagen erst drei Minuten warten muss, bis ein Laptop hochgefahren ist, oder drei Sekunden, die sein Smartphone braucht.
Bisweilen braucht es auch nicht die weltweite Vernetzung, die ein Smartphone ermöglicht. Alleine der einfach verfügbare Bild-/Video-/Audio-Rekorder im Smartphone ermöglicht eine ganze Reihe neuer Anwendungsmöglichkeiten.
Umgekehrt darf man nicht unterschätzen, welche Rolle gutes Design und klare Funktionalität spielen. Schon verhältnismäßige niedrige Hürden wie das wiederholte Eintippen von Zugangsdaten in einem Lernmanagementsystem können dafür sorgen, dass Systeme nicht in die schulischen Abläufe passen und nicht genutzt werden.
Auf der methodischen Ebene betonen mehrere Lehrkräfte, dass kleine Vereinfachungen große Auswirkungen haben, z.B. auf logistischer Ebene. „Heft vergessen gibt es nicht mehr“ ist ein Satz, der immer wieder zu hören ist. So sind es häufig kleine Vereinfachungen, die Unterricht grundsätzlich verändern können. Beispiel Nachschlagewerke: Wer einen digitalen Text zusammen mit einem digitalen Wörterbuch liest, kann Wörter in einem Bruchteil der Zeit nachschlagen, die es im papierenen Wörterbuch benötigte. Damit ändert sich grundlegend auch die Auswahl der Texte für den Unterricht. Schüler können nun selbstbestimmt Texte lesen, die sie ihren individuellen Interessen entsprechend im Web finden.
These 6: Digital und analog sind Teile derselben Welt.
Wenn andernorts grundsätzlich und bisweilen ideologisch über die „totale Digitalisierung“, die „Virtualisierung“ oder eine „Revolution“ gestritten wird, gehen die interviewten Lehrkräfte sehr pragmatisch vor. Es geht nicht um die Abschaffung der Schule durch E-Learning, sondern um die Erweiterung der Möglichkeiten im Unterricht. Selten werden 100 Prozent digitale Lösungen angestrebt. Vielmehr werden analog und digital pragmatisch gemischt und kombiniert, wenn zum Beispiel handgeschriebene Arbeiten per Smartphone-Kamera digitalisiert und verschickt werden. „Das Digitale ist kein Selbstzweck“ – dieser Satz ist für die interviewten Lehrkräfte vermutlich eine Platitüde.
Die interviewten Lehrkräfte teilen ihre Ideen und Konzepte und berichten offen von ihren Schwierigkeiten und Fehlschlägen – online und offline. Die (digitale) Vernetzung ist für sie auch Teil ihrer Professionen. Fast alle betreiben eigene Blogs oder sind auf Twitter aktiv. Sie treffen sich auf selbst organisierten Veranstaltungen wie den Educamps. Und häufig stellen sie ihre Arbeiten nicht nur öffentlich zur Verfügung, sondern versehen sie auch mit einer Lizenz zur Weiternutzung als Open Educational Resources (OER).
These 7: Es gibt eine große Vielfalt bei Hardware und Software.
Schaut man quer über die zehn Fallbeispiele, findet man die ganze Bandbreite unterschiedlicher Technik. Bei der Hardware sind es Tablets, Notebooks, Smartphones, PC-Ecken oder auch der Computerraum. Es gibt nicht „die beste Hardware“ für den Einsatz in der Schule. Wenn man einen Trend identifizieren sollte, wäre es wohl das Konzept BYOD, das mal mehr, mal weniger offiziell Einzug in Schulen hält. BYOD steht für „Bring Your Own Device“, also für die Nutzung der Geräte, die Schüler ohnehin schon in ihrem privaten Besitz haben.
Dieselbe Vielfalt findet sich auch auf der Ebene der Software wieder. Hier werden oft die vom Schulträger gestellten Lernmanagementsysteme wie Moodle oder iServ genutzt. Dort wo es erlaubt ist, kommen auch Dienste wie Google Drive, Dropbox oder Evernote zum Einsatz. Für die kollaborativen Arbeiten gibt es Blogs und Wikis, Etherpad und Google Docs. Hinzu kommen Programme und Webangebote für Inputs und Übungen. Auch hier gilt: Das perfekte System für die Schule gibt es nicht. Die Lehrkräfte entscheiden individuell, abhängig von ihren Rahmenbedingungen und Zielsetzungen.
Dabei ist der Stellenwert von generischen Angeboten häufig mindestens genau so hoch wie der von speziellen Lehr-Lern-Angeboten. („Generisch“ meint hier, dass die Software / Services nicht speziell für Unterricht und Schule gedacht sind, sondern zu verschiedenen Zwecken genutzt werden können. Eine Textverarbeitung ist ein klassisches Beispiel für eine generische Software.)
These 8: Datenschutz bleibt ein ungelöstes Problem.
Gerade wenn es um die Nutzung von Online-Angeboten geht, bleibt die Frage nach dem Datenschutz eine zentrale Herausforderung. Viele Praktiker bemängeln, dass ihnen institutionelle bzw. staatliche Stellen strikte Vorgaben machen, was alles nicht zu nutzen sei, dass ihnen aber gleichzeitig Alternativen fehlen. So bleibt die Verantwortung letztlich bei der einzelnen Lehrkraft oder der Schule, die damit zwangsläufig überfordert sein muss. Dabei gibt es vereinzelt durchaus Initiativen, bei denen Schulen, Schulträger und Schulaufsicht Hand in Hand gehen, um Rechtssicherheit und ein geschützten Raum für die Nutzung digitaler Medien zu schaffen (vgl. die nationalen Fallbeispiele in der Studie von Breiter, Stolpmann und Zeising in Kapitel 3).
These 9: Die EVA-Didaktik vernachlässigt den Mittelpunkt – das Lernen.
Das EVA-Prinzip stammt aus der Informatik. EVA steht für die drei Phasen Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe, in die sich die Informationsverarbeitung eines Computers untergliedern lassen kann. Ein Beispiel: Nach der Eingabe über die Tastatur findet die Verarbeitung der Daten im Prozessor statt und resultierte in der Ausgabe eines Ergebnisses auf dem Monitor.
In vielen Beispielen findet sich ein EVA-Prinzip auch für den Unterricht mit digitalen Medien. In der Eingabe-Phase recherchieren die Schüler nach Informationen, wofür sich digitale Medien und vor allem das Web außerordentlich gut eignen. In der Ausgabe-Phase werden Lernergebnisse als digitale Produkte entwickelt. Auch hier gibt es im digitalen Bereich großartige Möglichkeiten, von der Textverarbeitung oder Hypertexten in Blogs und Wikis, über Videos und Hörstücke bis zu interaktiven Formaten wie Zeitstrahl, Landkarte oder Geocache. Dazwischen liegt die Phase der Verarbeitung, in der vermutlich das Entscheidende stattfinden: das Lernen.
Zu dieser mittleren Phase finden sich weniger Überlegungen als zu Eingabe und Ausgabe, sowohl zur Methodik als auch zu den Werkzeugen. Die Phase der Verarbeitung, also die individuellen Lernprozesse, die mögliche Unterstützung durch Lehrkräfte und das Potential von digitalen Werkzeugen, verdienen besondere Aufmerksamkeit in der Weiterentwicklung von Unterricht mit digitalen Medien.
Dieser Artikel ist die Einleitung zur 10-teiligen Reihe „Chancen der Digitalisierung für individuelle Förderung im Unterricht – zehn gute Beispiele aus der Schulpraxis“. Mehr dazu …
Der Text steht unter der Lizenz CC BY SA 4.0. Als Autor soll Jöran Muuß-Merholz im Auftrag der Bertelsmann Stiftung genannt werden.